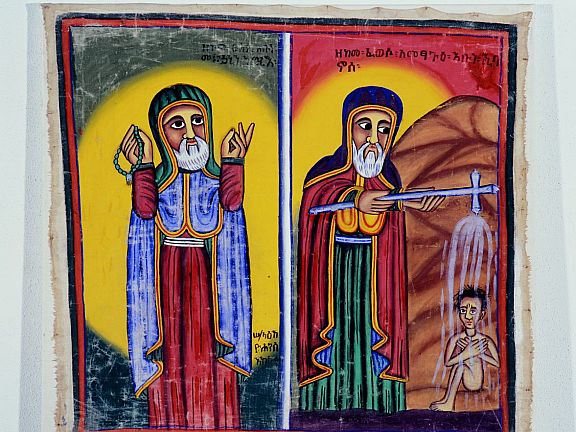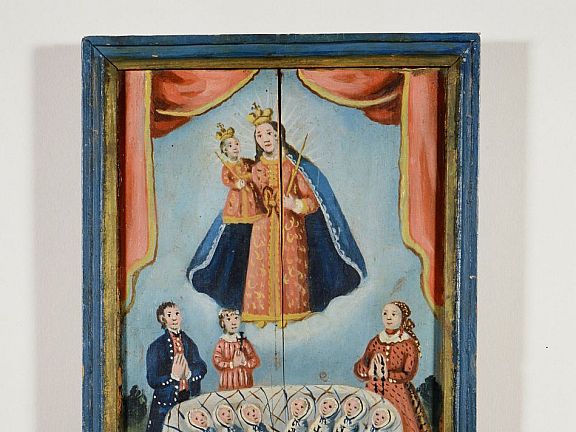Collection
Porzellanbecken mit Goldfond und dem Allianzwappen des Pfälzer Kurfürsten Carl Theodor sowie Ansichten seiner Residenzstadt Mannheim und zweier Schlösschen in den geschweiften Reserven
- Artist
- Porzellanmanufaktur Frankenthal
- Locality
- Frankenthal
- Date
- 1756
- Material
- Porzellan
- Dimensions
- B. 31,8 cm, H. 9,2 cm, T. 26,8 cm
- Location
- Bayerisches Nationalmuseum (Saal 95)
- Inventory Number
- 2017/52
- Relation
- Inv. No. 10/132 (Kanne)
- Acquisition
- Geschenk 2017, Erworben mit Mitteln aus dem Vermächtnis Harry Beyer, Aus dem Kunsthandel, London, Privatbesitz
Das Porzellanbecken ist mit dem Goldfond, dem Allianzwappen des Pfälzer Kurfürsten Carl Theodor sowie den Ansichten seiner Residenzstadt und kleinen Schlösschen in geschweiften Reserven ein prachtvolles, äußerst repräsentatives Objekt. Zusammen mit der zugehörigen Wasserkanne, die 1910 aus Wittelsbacher Besitz an das Bayerische Nationalmuseum überwiesen wurde (Inv.Nr. 10/132), bildet es ein historisch bedeutsames Ensemble. Die aus Rasierbecken und Kanne bestehende Toilettegarnitur gehört nämlich nicht nur zu den ganz frühen Erzeugnissen der 1755 gegründeten Frankenthaler Porzellanmanufaktur. Es wurde gemutmaßt, dass sie dem Kurfürsten als besonderes Geschenk überreicht worden sein könnte, als er mit seiner Gattin im Juni 1756 das erste Mal die Manufaktur besuchte. Dass die Frankenthaler Manufaktur so schnell nach ihrer Gründung so exquisite, überaus fein bemalte Porzellane herstellen konnte, liegt an ihrer Vorgeschichte in Straßburg. Bereits 1751 war es Straßburger Fayencefabrikant Paul Anton Hannong mit Hilfe des Wiener Arkanisten Josef Jakob Ringler gelungen, echtes Hartporzellan herzustellen. Es war das erste Hartporzellan in Frankreich, denn die Manufakturen in Vincennes, St. Cloud, Chantilly und Mennecy konnten nur sogenanntes Weichporzellan produzieren, basierend auf Glas und Tonfritten ohne die weiße Porzellanerde Kaolin. Die von Madame de Pompadour protegierte Manufaktur in Vincennes hatte aber 1745 das Monopol für die Herstellung von reich dekoriertem Porzellan im Königreich Frankreich erhalten, ein Privileg, das zwar 1752 aufgehoben, aber im August 1753 rückwirkend erneuert wurde. Im Februar 1754 erwirkte der Direktor von Vincennes eine Verfügung, dass Hannong seine bereits florierende Produktion in Straßburg binnen dreier Wochen einstellen musste, sonst würden seine Öfen eingerissen. Wegen der hohen Investitionen blieb Hannong nur die Verlagerung der Produktion ins Ausland. So wandte er sich an Carl Theodor, den Kurfürsten der benachbarten Pfalz, der ihm im Mai 1755 die Errichtung einer Porzellanmanufaktur genehmigte und günstige Konzessionen sowie einen finanziellen Zuschuss gewährte. Als Ort wurde die Dragonerkaserne in Frankenthal gewählt, das der Kurfürst zu einer modernen Industriestadt ausbauen wollte. Im Juni 1755 begann der Umzug der kompletten Manufaktur von Strassburg in das rund 150 km entfernte Frankenthal. So gelang hier fast aus dem Stand ein großartiger Aufschwung. Das Wasserkanne und das Rasierbecken sind genau datierbar, da sie die blaue Rautenschildmarke tragen, die in Frankenthal nur von Januar bis Mitte 1756 Verwendung fand und von dem steigenden Löwen aus dem Kurpfälzischen Wappen abgelöst wurde, um Verwechslungen mit der Marke der kurbayerischen Manufaktur zu vermeiden. Es sind nur ca. 25 Porzellane mit dieser Kennzeichnung bekannt, die vermutlich nur bei ein bis zwei Bränden benutzt wurde. Beide Geschirre tragen prominent platziert das von Löwen gehaltene Allianzwappen von Kurfürst Carl Theodor von Pfalz-Sulzbach (1724-1799) und seiner 1742 geehelichten Cousine Elisabeth Augusta (1721-1794). In den geschweiften Aussparungen auf der Fahne zeigt das Becken die Ansicht von drei seiner Residenzen, in der Mitte Mannheim. Auf den seitlichen Kartuschen der Kanne sind zwei Schlachtenszenen zu sehen, ein wichtiges Thema für einen Kurfürsten, der im Kriegsfall Kontingente für die Reichstruppen stellen musste. Dabei sind die Malereien der Wappen, Ansichten und Bataillen sowie auch der Blumen auf der Unterseite der Rasierschüssel bereits zu diesem frühen Zeitpunkt von feinster Qualität, für die Frankenthal auch später berühmt ist. Lit.: Ausst. Katalog ?Die Kunst Porcelain zu machen. Frankenthaler Porzellan 1755-1800?, Hrsg. Von Edgar J. Hürkey, Frankenthal 2005, S. 33-36, 41f., bes. S. 34, 42 und S. 187 Kat. Nr. 206. ? Versteigerungskatalog Sotheby´ London, 28.3.2017, Lot 413./Hantschmann, Dr. Katharina , 2017.07.20
BV046807037
Zum Objekt: Always up to date. Porcelain at the Munich Court, in: A Passion for Porcelain. Essays in Honour of Meredith Chilton, hrsg. von Karine Tsoumis und Vanessa Sigalas, Stuttgart 2020, S. 22-39, Abb. S. 37
Taxonomy
Becken