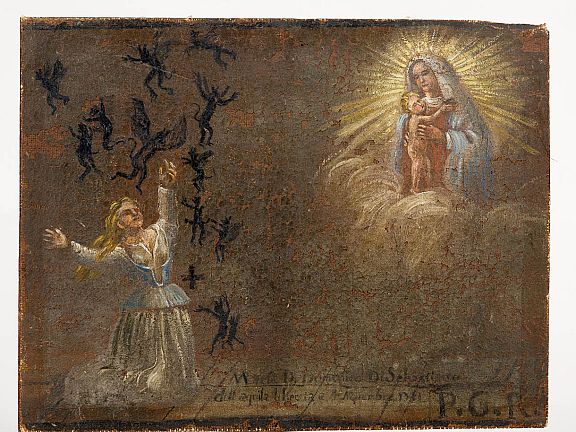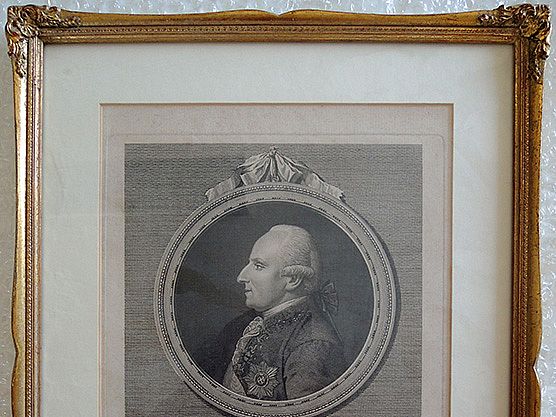Sammlung
Tierfigur: Adler
- Künstler/in
- –
- Entstehung
- Italien (?)
- Datierung
- 17. Jh.
- Material
- Erlenholz, geschnitzt, gefasst (alte Fassung)
- Maße
- H. 77,0 cm, B. 70,0 cm, T. 33,0 cm
- Standort
- Bayerisches Nationalmuseum (Sammlung Bollert)
- Inventarnummer
- 2004/390
- Bezug
- –
- Zugang
- Geschenk 2019, Eigentümergemeinschaft Bollert, Aus der Sammlung Gerhart Bollert, Aus der Sammlung Adolf von Beckerath
Die allseitige Ausarbeitung, insbesondere aber die schwungvoll elegante Seitenansicht, lassen eine freie Aufstellung als vorgesehen vermuten. Die rückwärtig sichtbaren Zapflöcher einer nicht mehr eindeutig bestimmbaren Vorrichtung erinnern auf den ersten Blick an eine Funktion als Lesepult, bei dem der Adler auf der Rückseite ehemals ein Pult zur Ablage eines Buches besessen hätte. Als Symbol des Evangelisten Johannes finden sich im Spätmittelalter eine Vielzahl solcher, u. a. etwa in den Niederlanden vor allem aus Messing gefertigter Pulte zur Lesung des Evangeliums./Weniger, Dr. Matthias
Die Anlage der weit nach hinten weisenden Flügel, insbesondere aber die im Unterschied zu vergleichbaren figürlich gestalteten Lesepulten geringe Größe des Adlers sprechen gegen diese Vermutung. Als Hoheitszeichen kann der Adler unterschiedlichsten Ausstattungszusammenhängen entstammen. Sein Stil erlaubt es, ihn ins 17. bzw. 18. Jahrhundert zu datieren, doch gestattet er mangels bisher fehlender überzeugender Vergleichsstücke bislang keine sichere Lokalisierung. Die Erle, aus der der Adler geschnitzt ist, kommt in Mitteleuropa vom Flachland bis zu ca. 1200 Meter in den Alpen vor und beantwortet deshalb die Frage nach der Herkunft des Stückes ebenfalls nicht. Aufgrund der Provenienz aus der vorwiegend italienische Skulpturen umfassenden Berliner Sammlung von Beckerath liegt jedoch eine italienische Herkunft nahe. In Italien ist immerhin die Benutzung von Erle auch gesichert. /Katalog BNM NF, Bd. 2, Sammlung Bollert, 2005/Weniger, Dr. Matthias
BV013331744
Zum Objekt: Ausst.-Kat. Kulturforum, Berlin, 30. Juni 2000 - 01. Oktober 2000: Skulpturen der Gotik und Renaissance. Die ehemalige Sammlung des Justizrats Dr. Gerhart Bollert, Régine Bonnefoit, Hartmut Krohm, Staatliche Museen zu Berlin (Hrsg.), Berlin 2000, Abb. S. 223, Kat.-Nr. 95
BV021267150
Zum Objekt: Mus.-Kat. Matthias Weniger, Jens Ludwig Burk, Die Sammlung Bollert. Bildwerke aus Gotik und Renaissance (Kataloge des Bayerischen Nationalmuseums; NF, Bd. 2), Renate Eikelmann (Hrsg.), München 2005, Kat.-Nr. 63 (mit Abb.)
Sammlung
Sammlung Bollert
Systematik
Tierfigur